abschnitt5
Zurück
75 Jahre Schöpfwerk
O T T E R N D O R F (Niederelbe) - 1928 - 2003
von Heinz G. B e u , S T A D E im August 2003
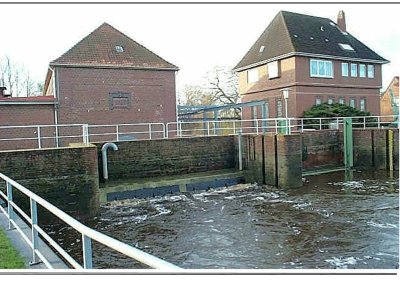


Geschichtliches zur Entwässerung
Die Kolonisation des Landes Hadeln begann 1106 und wurde durch
die Herzöge von Sachsen-Lauenburg und die Erzbischöfe von
Bremen initiiert.Unter Leitung der ansässigen Grundherren und
Mithilfe von holländischen Siedlern bildeten sich unter Leitung von
Schultheissen und Landschöffen die Kirchspiele (Gemeinden), ebenso
die Deich- und Entwässerungsverbände mit Schöffen und Deich-
Geschworenen. Die Erhaltung der damaligen Deiche durch alle
Eigentümer erfolgte nach dem Grundsatz:
"Keen nich will dieken, mut wieken".
Viele Seen und Moore brachten insbesondere dem Sietland
mit einer Höhe von - 1,00 m NN viel Wasser und die damaligen
Urgewässer in ihrem unregelmäßigen Verlauf konnten ohne Gefälle
den Abfluss nicht in die 20 Kilometer entfernte Elbe schaffen.
Überschwemmungen von langer Dauer mit großer Not der
Menschen (Malaria) waren die Folge. In dem unten dargestellten
Bodenprofil ist die tiefe und muldenförmige Lage der Hadelner
Marsch mit ihrer typischen Verteilung von Moor, Sand und Ton
(Klei) zu erkennen. Die für eine Marschenlandschaft notwendigen
Beetgräben waren zu damaliger Zeit nicht vorhanden.
Die Ursachen der fehlenden Vorflut
Folgende Gründe sind für eine fehlende Vorflut anzuführen:
1. die sehr niedrige Lage des Sietlandes mit Höhen bis zu -1,00 mNN,
insbesondere in den Gemarkungen Ihlienworth, Steinau u. Odisheim.
2. das fehlende natürliche Gefälle (das absolute Gefälle) auf das
Tidegewässer Elbe, welches als Hauptvorfluter dient.
3. der hohe Grundwasserspiegel, bedingt durch die undurchlässigen
tonhaltigen Kleiböden.
4. die das Sietland umgebenden höheren Randgebiete welche
aufgrund besserer Gefällverhältnisse ihre Abflüsse unverhältnis-
mäßig schnell durch die umliegenden Seen, den Stinstedter See,
den Bederkesaer See und den Flögelner See auf das Urgewässer
Medem zur Elbe entwässern.
5. die zu geringen Profilbreiten und -tiefen der Urgewässer von
Aue, Lehe, Mühe, Gösche und der Medem behinderten einen
ausreichenden Abfluss und es kam zu Überschwemmungen.
6. die gewundene Lienienführung der oben genannten Urgewässer
ergab gegenüber der kürzesten Verbindung zur Elbe wesentlich
längere Gewässerstrecken die damit dann auch den Abfluss
zeitlich sehr begrenzten.
7. durch zu kurze Sielzugzeiten, also durch die Gezeiten der Elbe
mit Ebbe und Flut; das heißt, nur bei Ebbstrom war ein Abfluss
in die Elbe möglich. Dieser Zustand wurde noch dadurch verstärkt,
dass später die drei Medemschleusen keine ausreichende
Kapazität, zu geringe Lichtweiten und Sohltiefen aufwiesen.
Das Land Hadeln mit seinem Hoch- und Sietland (1)
An der Mündung der Elbe liegt das Land Hadeln, das noch fast den
Charakter einer Seemarsch hat. Mit dem Begrif "Land Hadeln"
wird nur das Gebiet bezeichnet, welches sich im Mittelalter als
politisches Gebilde aus dem größeren Landschaftsraum, dem
alten Haduloha aussonderte, das heißt die Marsch zwischen
dem Geestrücken der Hohen Lieth und dem heutigen Hadelner
Kanal mit der Geestinsel Wanna. In diesem Gebiet überwiegt die
breite Hochlandszone in ihrer Bedeutung bei weitem die des
Sietlandes, zu dem in politischer Beziehung auch
das Geestkirchspiel Wanna gerechnet wird. Die Medem, der einzige
größere Wasserlauf, erschließt das Land zur Elbe hin.
Die Marschen unterstanden mit Ausnahme des Landes Hadeln
im Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit der Landeshoheit der
Erzbischöfe von Bremen. Die Landesherren der Hadler Marsch
waren die Herzöge von Sachsen-Lauenburg. So ist Hadeln ganz von
bremischen Ländern umgeben.
Gegenüber der Landesherrschaft, die durch die Gräfen ausgeübt
wurde, bestand in allen vier Marschländern eine ausgeprägte
Selbstverwaltung, die sich, über die inneren Angelegenheiten der
Länder hinaus, auch auf den diplomatischen Verkehr mit den
Nachbarländern und Städten erstreckte. Diese Selbstverwaltung
wurde von Gemeindevertretern und der gesamten Landesgemeinde,
der "universitas terrae", getragen. Die Formen dieser Selbst-
verwaltung sind im 16. Jahrhundert sehr verschieden; sie stimmen
nicht einmal innerhalb der einzelnenen Marschländer überein.
Im Lande Hadeln wurden die Gemeinden durch Schultheissen und
Schöffen vertreten.
Unmittelbar an der Mündung der Elbe liegt die größte und
politisch bedeutendste unserer Marschen, das Land Hadeln. Es
nimmt dadurch eine Sonderstellung ein, dass es der Landeshoheit der
Herzöge von Sachsen-Lauenburg untersteht. Ein von den Herzögen
eingesetzter Gräfe nimmt die Rechte der Landesherren wahr.
Daneben steht aber eine so ausgeprägte Selbstverwaltung der
bäuerlichen Landesgemeinde, dass sie zeitweilig der
Unabhängigkeit sehr nahe kommt.
Das Land Hadeln mit seinem Hoch- und Sietland (2)
Träger der Selbverwaltung ist die freie bäuerliche Bevölkerung,
welche durch ihre Vertreter nicht nur an der Verwaltung und
Leitung der Kirchspiele, sondern an der des gesamten Landes
teilnimmt. Die zwölf Kirchspiele sind die eigentlichen Zellen des
Landes. Der geographischen Gliederung des Landes in Hochland
und Sietland schließt sich die politische an.
Die sieben Kirchspiele des Hochlandes: Altenbruch, L�dingworth,
Nordleda, Westerende-Otterndorf, Osterende-Otterndorf,
Neuenkirchen und Osterbruch bilden den sogenannten
ersten Stand. Das Sietland mit den Kirchspielen Oster-Ihlienworth,
Wester-Ihlienworth, Odisheim, Steinau und dem Geestkirchspiel
Wanna bezeichnet man als den zweiten Stand. Die Stadt Otterndorf
verkörpert den dritten Stand, hat aber für die Leitung des Landes
niemals eine bedeutende Rolle gespielt. Das Hochland hat von
jeher in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht die Führung
innegehabt.
Schulten und Schöffen sind bis ins 19. Jahrhundert stets Männer,
die eigenen Grundbesitz im Kirchspiel haben. Es gibt allerdings keine
Rechtsaufzeichnung, in welcher die Ausübung der Ämter an den
Besitz von Grund und Boden geknüpft ist, sie ergab sich indessen
durch die Praxis von selbst: Da Schulten und Schöffen ihre Ämter
ehrenamtlich verwalteten, konnten nur solche Männer sie
übernehmen, denen ein genügend großer Besitz gestattete, die
damit verbundenen Unkosten zu tragen und die notwendige Zeit
aufzuwenden. Nur bei diesen, welche selbst Grundbesitz im
Kirchspiel hatten, konnte auch die Kenntnis des Deichwesens
vorausgesetzt werden.
Der Warningsacker im Osterende des Kirchspiels Altenbruch war die
alte Landstätte, auf welcher Tagungen der gesamten Landesgemeinde
stattfanden, wenn dringende Landesangelegenheiten verhandelt
wurden. - Auf dem Warningsacker fand die Huldigung der
Landesgemeinde für einen neuen Herzog statt, die verbunden war
mit der Bestätigung der Privilegien des Landes.
Das Land Hadeln mit seinem Hoch- und Sietland (3)
Diese Huldigung wird kirchspielsweise geleistet. An die
Huldigungsformel ist die Berufung auf das alte Recht des Landes
angeschlossen.
"Ok so schal us use leve gnedighe here hertoch Erik vorghenomet
by all usem rechte laten dat wy van sinen olderen ghehabt hebben."
Wenn ein neuer Gräfe eingeführt wird, wird er dem Lande gleichfalls
auf dem Warningsacker vorgestellt. Hier muss der Gräfe schwören,
in Landesangelegenheiten nichts ohne Beratung und Einverständnis
der Schulten und Schöffen zu unternehmen, und alle Rechte und
Privilegien des Landes zu wahren.
Jedes der zwölf Hadeler Kirchspiele bildet einen eigenen Deichbezirk,
in welchem dem Schultheissen Deichaufsicht und Deichgericht
zustehen. Es gibt in Hadeln, im Gegensatz zu den Nachbarmarschen,
keine adligen Deichgerichte. - Die ersten Aufzeichnungen eines
Deichrechtes in Hadeln enthält das Weisthum von 1439 in den Punkten 20
bis 24. Danach muss jeder, der im Kirchspiel Erb und Eigen besitzt,
seinen Teil des Deiches, sein sogenanntes Deichpfand, instandhalten.
Auf dieser Pflicht,die streng wahrgenommen wird, beruht der
genossenschaftliche Zusammenschluss der Kirchspielsleute. Das
tadellose Funktionierern des Deich- und Entwässerungssystems bildet
die Lebensgrundlage aller Marschkirchspiele. Die Deichpfänder eines
Kirchspiels liegen über den Elbdeich verstreut, um bei Deichbrüchen
eine zu starke Belastung einzelner Kirchspiele zu vermeiden. -
Der Schultheiss kündigt im Kirchspiel die Deichschau an.
Der Schultheiss hält zusammen mit den Landschöffen und besonderen
Geschworenen, welche für die Instandhaltung des Deiches und
der Schleusen verantwortlich sind, die Deichschau, zu welcher
der Deich schaufrei gemacht werden muss. Im Anschluss daran findet
das Deichgericht statt, in welchem die Säumigen bestraft werden.
Das Deichgericht, das sich aus dem Schultheissen, den Schöffen und
den Geschworenen zusammensetzt, wird als das "Schwarengericht"
bezeichnet. Bei den oben genannten Schöffen handelt es sich
nicht um die Landschöffen, sondern um besondere Kirchspielschöffen,
die mit den Geschworenen das Deichwesen zubeaufsichtigen haben und
im Rang weit hinter den Landschöffen zurückstehen.
Abschnittsw. entnommen aus "Die Verfassung der Marschen am linken Ufer der Elbe im Mittelalter"
von Ingeborg Mangels; 1957. (Landschöffe = Landschöpf).
Hiermit endet der Bericht auf der Hompage "ebbeundflut " .
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!